 Kann man ein Museum empfehlen, zu dessen spektakulärsten Ausstellungsstücken eine blutige Unterhose zählt? Immerhin setzt das Markgrafen-Museum in Ansbach (Bayern) die Kaspar Hauser-Story geschickt und durchaus seriös in Szene. Und macht deutlich, wer der schon zu seinen Lebzeiten rätselumwitterte “Findling” noch mal war und warum seine Geschichte immer noch faszinieren kann.
Kann man ein Museum empfehlen, zu dessen spektakulärsten Ausstellungsstücken eine blutige Unterhose zählt? Immerhin setzt das Markgrafen-Museum in Ansbach (Bayern) die Kaspar Hauser-Story geschickt und durchaus seriös in Szene. Und macht deutlich, wer der schon zu seinen Lebzeiten rätselumwitterte “Findling” noch mal war und warum seine Geschichte immer noch faszinieren kann.

 Wobei die übrigens, den Infos im Museum zufolge, noch immer nicht aufgelöst ist, weil der “Spiegel” und eine Arte/ ZDF-Dokumentation, als sie 1996 bzw. 2002/ 03 aktuellen Kaspar Hauser-Content herstellten, zwar jeweils DNA-Proben anfertigen ließen, aber zu gegensätzlichen Ergebnissen gelangten. Außer von der Unterhose stammt das analysierte Material auch von Haarlocken, die das Museum ebenfalls enthält (Details: Wikipedia). Die seit 1833 entstandene Spannung bleibt sozusagen erhalten.
Wobei die übrigens, den Infos im Museum zufolge, noch immer nicht aufgelöst ist, weil der “Spiegel” und eine Arte/ ZDF-Dokumentation, als sie 1996 bzw. 2002/ 03 aktuellen Kaspar Hauser-Content herstellten, zwar jeweils DNA-Proben anfertigen ließen, aber zu gegensätzlichen Ergebnissen gelangten. Außer von der Unterhose stammt das analysierte Material auch von Haarlocken, die das Museum ebenfalls enthält (Details: Wikipedia). Die seit 1833 entstandene Spannung bleibt sozusagen erhalten.
 Es gibt in Ansbach einen regelrechten Kaspar Hauser-Rundgang und diverse ziemlich neue Denkmäler. Am eindrucksvollsten ist jedoch der Tatort, an dem Hauser 1833 tödlich verletzt wurde: der Hofgarten. Die Behauptung, jedem Einwohner Ansbachs könnte darin ein eigenes Fußballfeld zugeteilt werden, wäre vermutlich grob falsch, gibt aber eine Vorstellung von der gewaltigen Größe. Eine barocke Orangerie von 102 Metern Länge eifert dem damals omnipräsenten Vorbild Versailles an, eine vierfache Lindenallee ist immerhin 550 Meter lang und schön fürs Auge. Kollateralnutzen: Vom drumherum rauschenden Autoverkehr (der im bayerischen Franken ja besonders rauscht), ist allerhand zu hören, aber nichts zu sehen.
Es gibt in Ansbach einen regelrechten Kaspar Hauser-Rundgang und diverse ziemlich neue Denkmäler. Am eindrucksvollsten ist jedoch der Tatort, an dem Hauser 1833 tödlich verletzt wurde: der Hofgarten. Die Behauptung, jedem Einwohner Ansbachs könnte darin ein eigenes Fußballfeld zugeteilt werden, wäre vermutlich grob falsch, gibt aber eine Vorstellung von der gewaltigen Größe. Eine barocke Orangerie von 102 Metern Länge eifert dem damals omnipräsenten Vorbild Versailles an, eine vierfache Lindenallee ist immerhin 550 Meter lang und schön fürs Auge. Kollateralnutzen: Vom drumherum rauschenden Autoverkehr (der im bayerischen Franken ja besonders rauscht), ist allerhand zu hören, aber nichts zu sehen.
 Solche Hofgärten konnten natürlich von lokalen Sonnenkönigen errichtet, hier also jenen Markgrafen, denen das proppenvolle Markgrafen-Museum (das aber auch noch einem Dinosaurierschädel Platz bietet) naheliegenderweise ebenfalls viel Raum widmet.
Solche Hofgärten konnten natürlich von lokalen Sonnenkönigen errichtet, hier also jenen Markgrafen, denen das proppenvolle Markgrafen-Museum (das aber auch noch einem Dinosaurierschädel Platz bietet) naheliegenderweise ebenfalls viel Raum widmet.
 Das mag ermüden, wenn man zuvor schon die Kaspar Hauser-Story verfolgt hat. Doch “sozusagen von Markgraf zu Markgraf” die Stationen des Fürstentums Brandenburg-Ansbach durchzugehen, hat seine Berechtigung, weil jeder von ihnen (die Wikipedia listet sie, die dynastisch betrachtet Hohenzollern waren, daher “Brandenburg-“, übersichtlich auf) naheliegenderweise anders drauf war als der vorherige, also ungefähr der eine die deutsche Oper, der andere die italienische und der nächste dann die Fayence förderte.
Das mag ermüden, wenn man zuvor schon die Kaspar Hauser-Story verfolgt hat. Doch “sozusagen von Markgraf zu Markgraf” die Stationen des Fürstentums Brandenburg-Ansbach durchzugehen, hat seine Berechtigung, weil jeder von ihnen (die Wikipedia listet sie, die dynastisch betrachtet Hohenzollern waren, daher “Brandenburg-“, übersichtlich auf) naheliegenderweise anders drauf war als der vorherige, also ungefähr der eine die deutsche Oper, der andere die italienische und der nächste dann die Fayence förderte.
 Die überraschten Untertanen mussten immer mitziehen (und sich z.B. im evangelischen Fürstentum, falls sie unverheiratet starben, mit einer “Totenkrone” bestatten lassen – noch so eine Kuriosität des Ansbacher Museums).
Die überraschten Untertanen mussten immer mitziehen (und sich z.B. im evangelischen Fürstentum, falls sie unverheiratet starben, mit einer “Totenkrone” bestatten lassen – noch so eine Kuriosität des Ansbacher Museums).
 Der letzte Markgraf Christian Friedrich Karl Alexander hatte dann keine Lust mehr und verkaufte sein Land an die Preußen (also an die “großen” Hohenzollern, ähnlich wie es die katholischen Hohenzollern in Sigmaringen ein gutes halbes Jahrhundert später auch taten). So wurden die Gegend um Ansbach und Bayreuth ein paar Jahre lang, wie das Christopher Clark in seinem “Preußen”-Buch formuliert, zum “Versuchslabor in Sachen Verwaltungsreform” für den preußischen Minister Karl August Freiherr von Hardenberg – also für jene Stein-Hardenbergschen Reformen, die in Preußen selbst im 19. Jahrhundert sehr wichtig wurden.
Der letzte Markgraf Christian Friedrich Karl Alexander hatte dann keine Lust mehr und verkaufte sein Land an die Preußen (also an die “großen” Hohenzollern, ähnlich wie es die katholischen Hohenzollern in Sigmaringen ein gutes halbes Jahrhundert später auch taten). So wurden die Gegend um Ansbach und Bayreuth ein paar Jahre lang, wie das Christopher Clark in seinem “Preußen”-Buch formuliert, zum “Versuchslabor in Sachen Verwaltungsreform” für den preußischen Minister Karl August Freiherr von Hardenberg – also für jene Stein-Hardenbergschen Reformen, die in Preußen selbst im 19. Jahrhundert sehr wichtig wurden.
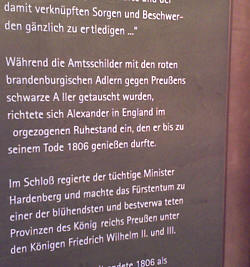 Wobei Ansbach zu dem Zeipunkt aber schon wieder nicht mehr preußisch war, da die Preußen aus ihrer süddeutschen Exklave wieder abzogen, als die französischen Armeen Napoleons heranzogen, die die Stadt dann den mit ihnen verbündeten Bayern übergaben (die jedoch kamen, um zu bleiben).
Wobei Ansbach zu dem Zeipunkt aber schon wieder nicht mehr preußisch war, da die Preußen aus ihrer süddeutschen Exklave wieder abzogen, als die französischen Armeen Napoleons heranzogen, die die Stadt dann den mit ihnen verbündeten Bayern übergaben (die jedoch kamen, um zu bleiben).
 Zurselben Zeit lebte der letzte Ex-Markgraf mit einer jährlichen Leibrente von 300.000 Gulden und seiner Geliebten, der britischen Schriftstellerin Elizabeth Craven, als Pferdezüchter in England, was schon daher eine sehr gute Wahl war, da in Kontinentaleuropa damals ganz besonders viel Krieg herrscht. Das allerdings das deutet das Ansbacher Markgrafen-Museum nur sehr dezent an. Denn heftige Loyalität zu ehemaligen lokalen Fürsten, auch noch Jahrhunderte später, bildet einen der gemeinsamsten Nenner in der deutschen Städtchenlandschaft.
Zurselben Zeit lebte der letzte Ex-Markgraf mit einer jährlichen Leibrente von 300.000 Gulden und seiner Geliebten, der britischen Schriftstellerin Elizabeth Craven, als Pferdezüchter in England, was schon daher eine sehr gute Wahl war, da in Kontinentaleuropa damals ganz besonders viel Krieg herrscht. Das allerdings das deutet das Ansbacher Markgrafen-Museum nur sehr dezent an. Denn heftige Loyalität zu ehemaligen lokalen Fürsten, auch noch Jahrhunderte später, bildet einen der gemeinsamsten Nenner in der deutschen Städtchenlandschaft.
